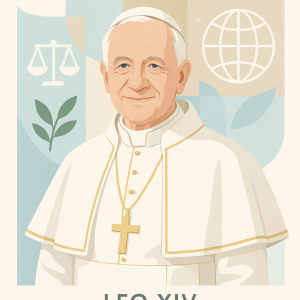
Leo XIV. tritt in die Fußstapfen seines Vorgängers Franziskus
Edgar L. Gärtner
Das Armutsgelübde ihres römisch-katholischen Bettelordens hat berühmte Dominikaner wie den Italiener Thomas von Aquin sowie später die Spanier Domingo de Soto und Juan de Mariana nicht davon abgehalten, die geistigen Grundlagen des Kapitalismus in Form des zivilen Naturrechts zu erarbeiten. Der wenigstens partielle Übergang zur kapitalistischen Form des Wirtschaftens hat es seit dem Ende des 20. Jahrhunderts Milliarden von Erdenbürgern ermöglicht, der Armut zu entkommen. Die meisten der heute lebenden Menschen verdanken ihr Überleben buchstäblich dem Kapitalismus, denn die vorkapitalistische Subsistenzwirtschaft ermöglicht nicht die Ernährung von über 8 Milliarden Menschen. Da der Kapitalismus eine Wirtschaftsweise, aber kein geschlossenes System darstellt, ist er auch ohne Weiteres mit religiös begründeter freiwilliger Armut vereinbar.
Das Lehrschreiben „Dilexi te“
Doch unser neuer Papst Leo XIV., dem ich als einfacher Gläubiger eine Gnadenfrist eingeräumt habe, schloss sich kürzlich in seinem ersten Lehrschreiben (Apostolische Exhortation) mit dem Titel „Dilexi te“ (deutsche Kurzfassung hier) ausdrücklich dem Verdikt seines Vorgängers an: „Diese Wirtschaft tötet.“ Er umschreibt das lediglich mit etwas anderen Worten, indem er die nationale Abschottung und Ausgrenzung der Armen beziehungsweise Zurückweisung von Migranten anprangert und die unter US-Präsident Donald Trump verfügte Kürzung von Sozial- und Entwicklungshilfe-Programmen als unchristlich verdammt. Stattdessen fordert er weltweite solidarische Zusammenarbeit ausgehend von den Bedürfnissen der Armen. Mit jedem zurückgewiesenen Migranten klopfe „Christus selbst an die Türen der Gemeinschaft.“ Kein Wort über die mit der unkontrollierten Massen-Migration verbundene Explosion von Gewaltverbrechen. Weiterlesen

 Die Evolutionstheorie nach Charles Darwin ist durch und durch unfertig. Versteinerte Knochen beweisen Abstammungslinien längst nicht so zwingend, wie in Schulbüchern dargestellt. Das gilt besonders für die Abstammung des Menschen. Heute bringen Molekulargenetik und Entwicklungsbiologie mehr Licht in vermutete Zusammenhänge als die Paläontologie. Doch Martin Rhonheimer beschäftigt sich kaum mit biologischen Details. Als Philosoph und Theologe interessieren ihn in erster Linie die Konsequenzen von Erkenntnissen über unsere Herkunft für unser Menschenbild. Rhonheimer, ein Schüler Hermann Lübbes, lehrt an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom, ist Mitglied der Hayek-Gesellschaft und ist gerade dabei, in Wien das Austrian Institute of Economics and Social Philosophy aufzubauen.
Die Evolutionstheorie nach Charles Darwin ist durch und durch unfertig. Versteinerte Knochen beweisen Abstammungslinien längst nicht so zwingend, wie in Schulbüchern dargestellt. Das gilt besonders für die Abstammung des Menschen. Heute bringen Molekulargenetik und Entwicklungsbiologie mehr Licht in vermutete Zusammenhänge als die Paläontologie. Doch Martin Rhonheimer beschäftigt sich kaum mit biologischen Details. Als Philosoph und Theologe interessieren ihn in erster Linie die Konsequenzen von Erkenntnissen über unsere Herkunft für unser Menschenbild. Rhonheimer, ein Schüler Hermann Lübbes, lehrt an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom, ist Mitglied der Hayek-Gesellschaft und ist gerade dabei, in Wien das Austrian Institute of Economics and Social Philosophy aufzubauen.