 Udo Ulfkotte: Kein Schwarz, kein Rot, kein Gold. Armut für alle im „Lustigen Migrantenstadl“. Kopp Verlag, Rottenburg 2010. 372 S. € 19,95
Udo Ulfkotte: Kein Schwarz, kein Rot, kein Gold. Armut für alle im „Lustigen Migrantenstadl“. Kopp Verlag, Rottenburg 2010. 372 S. € 19,95
Udo Ulfkottes neues Buch erschien vielleicht nicht zum günstigste Zeitpunkt, weil es im Rummel um das wenige Tage zuvor erschienene themenverwandte Buch Thilo Sarrazins unterzugehen drohte. Dennoch würde ich mich über die Kosten kulturferner Zuwanderung lieber im Buch des ehemaligen FAZ-Redakteurs informieren, da es nicht durch eine sozialdemokratische Weltsicht vorbelastet ist. Gleichwohl dürfte auch Ulfkottes höchst aktuelles Pamphlet die meisten Leser ratlos lassen. Weiterlesen

 Das erstmals 1952 erschienene „politische Testament“ des Ökonomen der österreichischen Schule und Schweizer Bankiers Felix Somary galt bei ef nahestehenden Autoren schon länger als Geheimtipp, war aber nicht mehr auffindbar. Nun hat es der TvR-Medienverlag, versehen mit einem alten und einem neuen Vorwort von Otto von Habsburg und Nachworten von Carl J. Burkhardt und Wilhelm Röpke sowie einem Nachruf von Marion Gräfin Dönhoff, mit Zustimmung der Erben neu herausgebracht. Der belesene und weltläufige Somary war nicht nur mit den genannten Persönlichkeiten,
Das erstmals 1952 erschienene „politische Testament“ des Ökonomen der österreichischen Schule und Schweizer Bankiers Felix Somary galt bei ef nahestehenden Autoren schon länger als Geheimtipp, war aber nicht mehr auffindbar. Nun hat es der TvR-Medienverlag, versehen mit einem alten und einem neuen Vorwort von Otto von Habsburg und Nachworten von Carl J. Burkhardt und Wilhelm Röpke sowie einem Nachruf von Marion Gräfin Dönhoff, mit Zustimmung der Erben neu herausgebracht. Der belesene und weltläufige Somary war nicht nur mit den genannten Persönlichkeiten, Der aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen in Süddeutschland lebende Autor Torsten Mann wurde vor zwei Jahren mit dem provokativen Buch „Weltoktober. Wer plant die sozialistische Weltregierung?“ bekannt. Er vertritt dort die These, das durch Michail Gorbatschows „Perstroika“ eingeleitete Ende des „realen Sozialismus“ sei planmäßiges Resultat einer nach dem Tod Stalins eingeleiteten Wende in der Strategie des Weltkommunismus mit dem Ziel, statt durch stalinistischen Terror durch eine Charmeoffensive zur Weltrevolution zu gelangen. Mann stützte sich dabei hauptsächlich auf die Schriften einer Reihe von Überläufern östlicher Geheimdienste wie Michail Goleniewski, Anatoliy Golitsyn, Jan Sejna, Ladislav Bittman, Ion Pacepa, Victor Suworow, Stanislav Lunev, Yuri Bezmenov und Kanatjan Alibekow, von denen einige allerdings im Verdacht stehen, Doppelagenten gewesen zu sein.
Der aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen in Süddeutschland lebende Autor Torsten Mann wurde vor zwei Jahren mit dem provokativen Buch „Weltoktober. Wer plant die sozialistische Weltregierung?“ bekannt. Er vertritt dort die These, das durch Michail Gorbatschows „Perstroika“ eingeleitete Ende des „realen Sozialismus“ sei planmäßiges Resultat einer nach dem Tod Stalins eingeleiteten Wende in der Strategie des Weltkommunismus mit dem Ziel, statt durch stalinistischen Terror durch eine Charmeoffensive zur Weltrevolution zu gelangen. Mann stützte sich dabei hauptsächlich auf die Schriften einer Reihe von Überläufern östlicher Geheimdienste wie Michail Goleniewski, Anatoliy Golitsyn, Jan Sejna, Ladislav Bittman, Ion Pacepa, Victor Suworow, Stanislav Lunev, Yuri Bezmenov und Kanatjan Alibekow, von denen einige allerdings im Verdacht stehen, Doppelagenten gewesen zu sein. 

 Der bekannte Mundstuhl-Comedian Lars Niedereichholz (Jahrgang 1968) schwimmt mit seinem bösartig anti-grünen Roman-Erstling mit dem verheißungsvollen Titel „Unknorke“ auf einer Woge des Erfolgs. Auch seine gut besuchten Lesungen, von denen ich eine während der Buchmesse in der Frankfurter Bar „Nachtleben“ genossen habe, sind Kabarettreif. „Unknorke“ bedeutet, wie man sich denken kann, das Gegenteil des im Multikulti-Alternativ-Newspeak für „gut“ stehenden Berlinerischen „knorke“. Es handelt sich beim vorliegenden Roman um die Geschichte des nicht mehr ganz so jungen Volkswirtschaftlers Marc, der nach einem wenig zielstrebigen Studium in der Chefetage der Alternativen Multikulturellen Ökologie Bank (kurz AMÖB) anheuert und gleichzeitig mit seiner hochschwangeren Frau Nadja in ein nagelneues, aber leider undichtes Reihenhaus einzieht. Bald stellt es sich heraus, dass es sich bei der AMÖB um eine chaotisch gemanagte Schwindelfirma handelt, die die Weltverbesserungs-Sehnsucht grüner Naivlinge zu Geld macht. Mehr möchte ich hier von dem pointenreichen und ausgesprochen lustigen Büchlein nicht verraten. Manches erscheint mir allerdings etwas zu dick aufgetragen.
Der bekannte Mundstuhl-Comedian Lars Niedereichholz (Jahrgang 1968) schwimmt mit seinem bösartig anti-grünen Roman-Erstling mit dem verheißungsvollen Titel „Unknorke“ auf einer Woge des Erfolgs. Auch seine gut besuchten Lesungen, von denen ich eine während der Buchmesse in der Frankfurter Bar „Nachtleben“ genossen habe, sind Kabarettreif. „Unknorke“ bedeutet, wie man sich denken kann, das Gegenteil des im Multikulti-Alternativ-Newspeak für „gut“ stehenden Berlinerischen „knorke“. Es handelt sich beim vorliegenden Roman um die Geschichte des nicht mehr ganz so jungen Volkswirtschaftlers Marc, der nach einem wenig zielstrebigen Studium in der Chefetage der Alternativen Multikulturellen Ökologie Bank (kurz AMÖB) anheuert und gleichzeitig mit seiner hochschwangeren Frau Nadja in ein nagelneues, aber leider undichtes Reihenhaus einzieht. Bald stellt es sich heraus, dass es sich bei der AMÖB um eine chaotisch gemanagte Schwindelfirma handelt, die die Weltverbesserungs-Sehnsucht grüner Naivlinge zu Geld macht. Mehr möchte ich hier von dem pointenreichen und ausgesprochen lustigen Büchlein nicht verraten. Manches erscheint mir allerdings etwas zu dick aufgetragen.  „Die Leser dieses Buches wissen, dass der Gärtner keine Chance hat. Er denkt nur im Rahmen des menschlichen Maßes.“ Nach diesem ernüchternden Resumé könnte der Rezensent, der nicht nur Gärtner heißt und selbst zwei Gärten pflegt, sondern sich auch zu einer Art von Gärtner-Philosophie bekennt, das Buch des niederländischen Geologie-Professors Salomon Kroonenberg gleich wieder aus der Hand legen. Doch was Kroonenberg als Fachmann für langfristige Betrachtungen seinen Kollegen von der unklar umrissenen Disziplin „Klimaforschung“ ins Stammbuch schreibt, sollte meines Erachtens alle naturwissenschaftlich und politisch interessierten zum Nachdenken bringen.
„Die Leser dieses Buches wissen, dass der Gärtner keine Chance hat. Er denkt nur im Rahmen des menschlichen Maßes.“ Nach diesem ernüchternden Resumé könnte der Rezensent, der nicht nur Gärtner heißt und selbst zwei Gärten pflegt, sondern sich auch zu einer Art von Gärtner-Philosophie bekennt, das Buch des niederländischen Geologie-Professors Salomon Kroonenberg gleich wieder aus der Hand legen. Doch was Kroonenberg als Fachmann für langfristige Betrachtungen seinen Kollegen von der unklar umrissenen Disziplin „Klimaforschung“ ins Stammbuch schreibt, sollte meines Erachtens alle naturwissenschaftlich und politisch interessierten zum Nachdenken bringen. 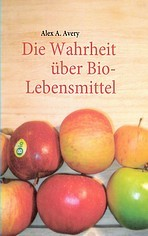 Bio-Lebensmittel sind „in“. Selbst bei großen Discounter-Ketten wie „Lidl“ oder „ALDI“ gibt es inzwischen ein reichhaltiges Sortiment an Obst und Gemüse aus ökologischem Anbau. Bei Früchten wie Bananen oder Zitronen haben die Kunden oft gar keine andere Wahl mehr, als zu deutlich teurer Öko-Ware zu greifen. Solange man für sein Geld eine überzeugende Qualität bekommt, ist das kein grundsätzliches Problem. Sind Bio-Produkte aber im Hinblick auf den Geschmack, den Nährwert und ihren Gehalt an Giftrückständen wirklich durchgängig besser? Dieser Frage geht der US-Biochemiker Alex A. Avery in einem gut dokumentierten Sachbuch nach, das in den USA zum Bestseller wurde. Der Jenaer Kleinverlag Thuss & van Riesen hat das Buch jetzt ins Deutsche übersetzen lassen. Das lag insofern nahe, als darin auch die Wurzeln und die Praxis des Öko-Landbaus in deutschsprachigen Ländern eine bedeutende Rolle spielen. Dabei wurden leider einige Flüchtigkeitsfehler übersehen.
Bio-Lebensmittel sind „in“. Selbst bei großen Discounter-Ketten wie „Lidl“ oder „ALDI“ gibt es inzwischen ein reichhaltiges Sortiment an Obst und Gemüse aus ökologischem Anbau. Bei Früchten wie Bananen oder Zitronen haben die Kunden oft gar keine andere Wahl mehr, als zu deutlich teurer Öko-Ware zu greifen. Solange man für sein Geld eine überzeugende Qualität bekommt, ist das kein grundsätzliches Problem. Sind Bio-Produkte aber im Hinblick auf den Geschmack, den Nährwert und ihren Gehalt an Giftrückständen wirklich durchgängig besser? Dieser Frage geht der US-Biochemiker Alex A. Avery in einem gut dokumentierten Sachbuch nach, das in den USA zum Bestseller wurde. Der Jenaer Kleinverlag Thuss & van Riesen hat das Buch jetzt ins Deutsche übersetzen lassen. Das lag insofern nahe, als darin auch die Wurzeln und die Praxis des Öko-Landbaus in deutschsprachigen Ländern eine bedeutende Rolle spielen. Dabei wurden leider einige Flüchtigkeitsfehler übersehen.