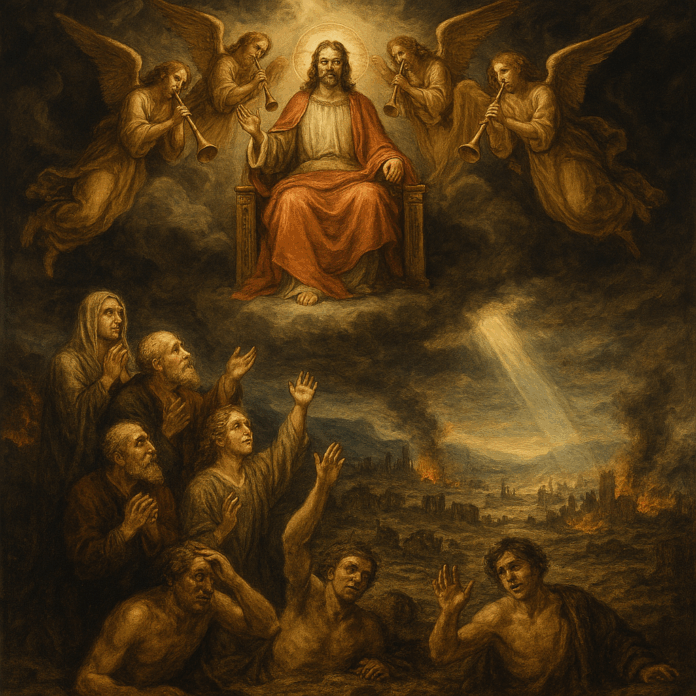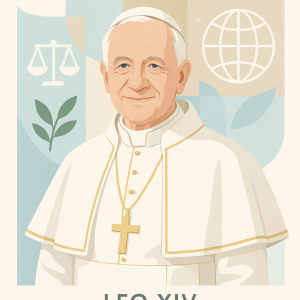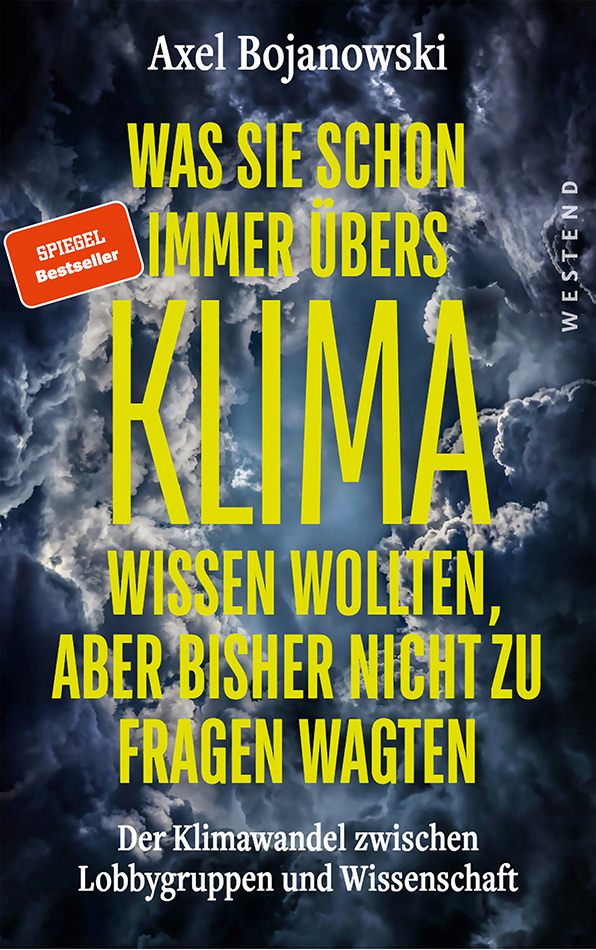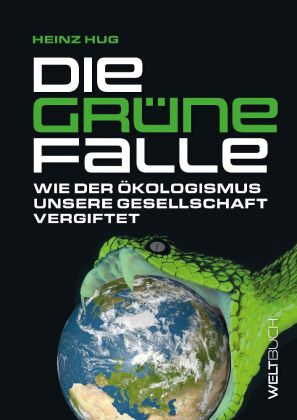Lieblosigkeit führt mit Notwendigkeit zum Chaos – auch in der Energiepolitik.
Edgar L. Gärtner

KI-Bild MsCopilot
Als grundkonservativer Mensch habe ich mich immer für den Naturschutz engagiert. Schon in den 60er Jahren (ich war noch Schüler) hat mich der Bürgermeister der kleinen ländlichen Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, zum Vogelschutz-Beauftragten ernannt. Später während meines Biologiestudiums an der Frankfurter Goethe-Universität sah ich das Anliegen des Naturschutzes am besten bei der politischen Linken aufgehoben. Das war wohl ein Missverständnis.
Seit dem Beginn der 70er Jahre publizierte ich regelmäßig über Fragen der Ökologie und beteiligte mich intensiv an der Auseinandersetzung mit der vom elitären Club of Rome in Auftrag gegebenen und von der Volkswagen-Stiftung finanzierten Simulationsstudie „Die Grenzen des Wachstums“, die lediglich die Aussagen der vom britischen Landgeistlichen Thomas Robert Malthus 1798 anonym veröffentlichten Bevölkerungstheorie in die Sprache des Computerzeitalters übertrug. Es war kein Zufall, dass ich mich dabei vorwiegend marxistischer Argumente bediente. Denn die in meinen Augen konsequenteste Kritik am Malthusianismus wurde im 19. Jahrhundert von Karl Marx und Friedrich Engels formuliert. Malthus und seine zahlreichen Nachfolger sahen die Hauptursache für Armut und Elend in der Welt im Trieb, mehr Nachkommen zu zeugen, als die Erde ernähren kann. Die von ihnen verbreitete Angst vor einer Überbevölkerung diente der Rechtfertigung hartherziger Politik gegenüber den Armen.
Die beiden Säulenheiligen der materialistischen Geschichtsauffassung lenkten die Aufmerksamkeit demgegenüber zu Recht auf die Tatsache, dass Naturgüter erst durch die von Menschen erfundene Technik zu ökonomischen Ressourcen werden, dass es also absurd ist, von einem ein für alle Mal gegebenen Vorrat an Ressourcen auszugehen, Weiterlesen