Matthias Matussek: White Rabbit oder der Abschied vom gesunden Menschenverstand. Finanzbuchverlag – Edition Tichys Einblick, München 2018. 318 Seiten. € 22,99
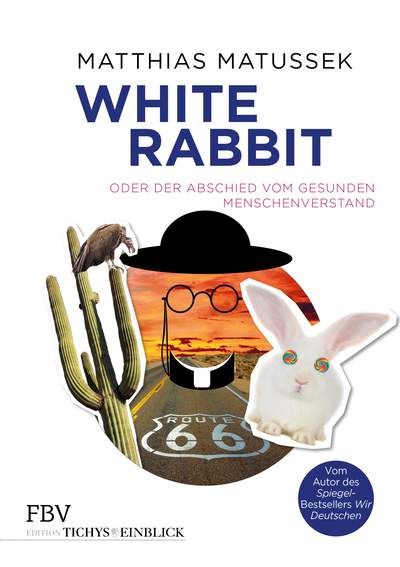
Der Ex-Hippie und orthodoxe Katholik Matthias Matussek, bekanntgeworden als „Edel-Feder“ des SPIEGEL, beschreibt in seinem neuesten Buch die Verfinsterung Deutschlands in den letzten drei Jahren anhand dessen, was ihm selbst bei der WELT zugestoßen ist. „…wir erleben das makabre Schauspiel einer Auflösung der Ordnung von oben, durch die Regierung“, schreibt Matussek und meint damit vor allem die von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Spätsommer 2015 durch die gesetzeswidrige Verweigerung von Grenzkontrollen ausgelöste Massen-Invasion junger Muslime, „Flüchtlinge“ oder „Neuansiedler“ genannt, die einen Rattenschwanz weiterer Gesetzesbrüche einschließlich Vergewaltigung und Mord nach sich zieht. Matussek vergleicht die ekstatische „Willkommenskultur“ von 2015 mit dem euphorischen „Augusterlebnis“ beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs hundert Jahre zuvor. Das alles war nur möglich, weil Frau Merkel in der neuen Generation politisch korrekter, d.h. verlogener und unkritischer Journalisten willfährige Helfer fand. Er würde deshalb heute den Beruf des Journalismus nicht mehr ergreifen, versichert Matussek. Um seinen Lesern zu zeigen, was ehrlicher Journalismus stattdessen leisten könnte, verweist er auf das Beispiel des zum Katholizismus konvertierten begnadeten britischen Schriftstellers und Journalisten Gilbert K. Chesterton (1874 – 1936), den man in Deutschland leider kaum noch als Polemiker, sondern fast nur noch als Autor der Pater-Brown-Krimis kennt. Schon in seinem Bestseller von 2006 „Wir Deutschen – warum die anderen uns gern haben können“ verteidigte Matussek wie sein Vorbild Chesterton Nation und Patriotismus als Produkte der menschlichen Seele, d.h. als geistige, nicht biologische Schöpfungen. Und er versucht seine Leser auch davon zu überzeugen, dass ein Leben ohne das Abenteuer des katholischen Glaubens mit seinen Paradoxa und Mysterien langweilig wäre. Nur die Mystik erlaube es den Menschen, in einer verrückten Welt geistig gesund zu bleiben. Wer auf purer Logik bestehe, lande hingegen geradewegs im Irrenhaus.


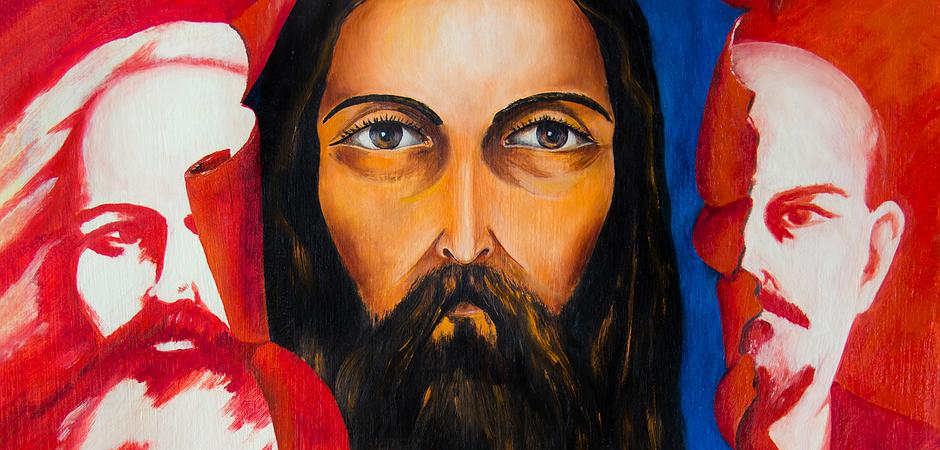
 Der „liberale“ Journalist Tobias Huch hat in dem auf Esoterik spezialisierten Verlag eine eigene Übersetzung der Jefferson-Bibel veröffentlicht. Thomas Jefferson (1743-1826) gehörte bekanntlich zu den Gründervätern der USA. Er galt nicht nur als der europäischen „Aufklärung“ verpflichtet, sondern auch als bibelfest. Allerdings verstand er die Bibel als Märchenbuch und wollte sie nur als moralische Anleitung verstehen. Er sah folglich alles, was darin über Wunder (einschließlich des Wunders der leiblichen Auferstehung Jesu Christi nach seinem Kreuzestod) berichtet wird, als überflüssig, wenn nicht irreführend und schädlich an. Als eine Zumutung muss ihm auch die Offenbarung des Johannes erschienen sein. So eliminierte er alles, was dem Geist der „Aufklärung“ widersprach und schuf damit ein Kompendium erbaulicher Sprüche und Handlungsempfehlungen, das sich heute wohl gut als Glaubensbekenntnis einer die „woke“ Einheitsreligion fordernden gnostischen Sekte eignen würde. Das Kompendium wurde allerdings erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also lange nach Jeffersons Tod, in Amerika veröffentlicht. Abgesehen von England, blieb das Büchlein, da nicht übersetzt, in Europa bislang weitgehend unbeachtet. Ob die nun vorliegende deutsche Übersetzung Wesentliches daran ändern wird, muss sich zeigen. Immerhin könnte Jeffersons Kompendium meines Erachtens die Erkenntnis fördern, dass die europäische „Aufklärung“, auf die sich Liberalismus und Sozialismus gleichermaßen berufen, im Kern eine in Selbstbeweihräucherung schwelgende gnostische Bewegung war. Vielleicht weckt die Jefferson-Bibel aber auch das Interesse an der richtigen Bibel. Die vier Evangelien des Neuen Testaments sind keine Sammlungen von Anekdoten, sondern Porträts des Erlösers Jesus Christus aus vier verschiedenen Perspektiven: Im Matthäus-Evangelium ist Jesus der König, im Markus-Evangelium hingegen der Gottesknecht, im Lukas-Evangelium der Seelenarzt und im Johannes-Evangelium schließlich das Fleisch gewordene Wort. Bibelforscher haben zeigen können, dass darin nichts zufällig ist. Edgar L. Gärtner
Der „liberale“ Journalist Tobias Huch hat in dem auf Esoterik spezialisierten Verlag eine eigene Übersetzung der Jefferson-Bibel veröffentlicht. Thomas Jefferson (1743-1826) gehörte bekanntlich zu den Gründervätern der USA. Er galt nicht nur als der europäischen „Aufklärung“ verpflichtet, sondern auch als bibelfest. Allerdings verstand er die Bibel als Märchenbuch und wollte sie nur als moralische Anleitung verstehen. Er sah folglich alles, was darin über Wunder (einschließlich des Wunders der leiblichen Auferstehung Jesu Christi nach seinem Kreuzestod) berichtet wird, als überflüssig, wenn nicht irreführend und schädlich an. Als eine Zumutung muss ihm auch die Offenbarung des Johannes erschienen sein. So eliminierte er alles, was dem Geist der „Aufklärung“ widersprach und schuf damit ein Kompendium erbaulicher Sprüche und Handlungsempfehlungen, das sich heute wohl gut als Glaubensbekenntnis einer die „woke“ Einheitsreligion fordernden gnostischen Sekte eignen würde. Das Kompendium wurde allerdings erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also lange nach Jeffersons Tod, in Amerika veröffentlicht. Abgesehen von England, blieb das Büchlein, da nicht übersetzt, in Europa bislang weitgehend unbeachtet. Ob die nun vorliegende deutsche Übersetzung Wesentliches daran ändern wird, muss sich zeigen. Immerhin könnte Jeffersons Kompendium meines Erachtens die Erkenntnis fördern, dass die europäische „Aufklärung“, auf die sich Liberalismus und Sozialismus gleichermaßen berufen, im Kern eine in Selbstbeweihräucherung schwelgende gnostische Bewegung war. Vielleicht weckt die Jefferson-Bibel aber auch das Interesse an der richtigen Bibel. Die vier Evangelien des Neuen Testaments sind keine Sammlungen von Anekdoten, sondern Porträts des Erlösers Jesus Christus aus vier verschiedenen Perspektiven: Im Matthäus-Evangelium ist Jesus der König, im Markus-Evangelium hingegen der Gottesknecht, im Lukas-Evangelium der Seelenarzt und im Johannes-Evangelium schließlich das Fleisch gewordene Wort. Bibelforscher haben zeigen können, dass darin nichts zufällig ist. Edgar L. Gärtner Ich gehöre sicher nicht zu den „Promis“, weil ich es, meinem Charakter entsprechend, vorziehe, im Hintergrund zu arbeiten. Deshalb gehöre ich auch nicht zu den Erst-Unterzeichnern der von Vera Lengsfeld initiierten und vom Dresdner Romancier Uwe Tellkamp auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse lancierten „Gemeinsame Erklärung 2018“ von Autoren. Ich habe mich dann aber ohne langes Nachdenken in die stündlich wachsende Zahl von Mitunterzeichnern eingereiht, sobald ich die nur aus zwei Sätzen bestehende Erklärung zu Gesicht bekam. Selbstverständlich ging es dabei auch um die Frage, ob ich mich da in guter Gesellschaft befinde.
Ich gehöre sicher nicht zu den „Promis“, weil ich es, meinem Charakter entsprechend, vorziehe, im Hintergrund zu arbeiten. Deshalb gehöre ich auch nicht zu den Erst-Unterzeichnern der von Vera Lengsfeld initiierten und vom Dresdner Romancier Uwe Tellkamp auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse lancierten „Gemeinsame Erklärung 2018“ von Autoren. Ich habe mich dann aber ohne langes Nachdenken in die stündlich wachsende Zahl von Mitunterzeichnern eingereiht, sobald ich die nur aus zwei Sätzen bestehende Erklärung zu Gesicht bekam. Selbstverständlich ging es dabei auch um die Frage, ob ich mich da in guter Gesellschaft befinde. Der Katholik Martin Mosebach, bekannt als Autor erfolgreicher Romane wie auch als scharfer Kritiker der Liturgie-Reform seiner Kirche nach dem II. Vatikanum, sieht im Bluts-Zeugnis der im Februar 2015 am libyschen Strand von vermummten IS-Terrorsten hingerichteten 21 christlichen Wanderarbeiter einen Anlass, um der Frage nachzugehen, wie die römische Kirche die Unterwerfung unter die relativistische Zivilreligion beziehungsweise die Islamisierung noch verhindern könnte. Das ägyptische Urvolk der Kopten hat 1.400 Jahre unter der Herrschaft des Islam – offenbar geistig unbeschadet – überstanden. Heute ist die Zahl der Kopten größer als je zuvor. Wie groß genau, verheimlicht die ägyptische Regierung allerdings. Die koptische Kirche, deren Zeitrechnung mit der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Diokletian beginnt (sie schreiben heute das Jahr 1800), verstand sich von Anfang an als Kirche der Märtyrer. Die römische Kirche hingegen ermöglichte ihren Mitgliedern nach der konstantinischen Wende weltlichen Erfolg. Gestützt auf das römische Recht, bekämpfte sie Häresien wie Manichäismus oder Millenarismus und nicht zuletzt den Islam zum Teil auch militärisch und war dabei zeitweise erfolgreich. Heute droht dem Christentum in Westeuropa trotzdem das Ende. Die Kopten hingegen haben die islamische Eroberung Ägyptens widerstandslos ertragen und dennoch ihren Glauben bewahrt. Das wirft die Frage nach dem Sinn unseres Geschichtsbildes auf: „Unser historisches Bewusstsein ist stark von den Rupturen und Traditionsbrüchen geprägt, welche die Epochen der europäischen Geschichte scharf voneinander abheben“, stellt Mosebach fest. „Darüber ist unser Sinn für die Kontinuitäten der Geschichte geschwächt worden, das Gefühl dafür, dass die Vergangenheit die Geschichte unserer Herkunft ist und in uns, bewusst oder unbewusst, fortdauert. (…) Nach Jesu Himmelfahrt lebte die Welt in einem ständigen Jetzt.“
Der Katholik Martin Mosebach, bekannt als Autor erfolgreicher Romane wie auch als scharfer Kritiker der Liturgie-Reform seiner Kirche nach dem II. Vatikanum, sieht im Bluts-Zeugnis der im Februar 2015 am libyschen Strand von vermummten IS-Terrorsten hingerichteten 21 christlichen Wanderarbeiter einen Anlass, um der Frage nachzugehen, wie die römische Kirche die Unterwerfung unter die relativistische Zivilreligion beziehungsweise die Islamisierung noch verhindern könnte. Das ägyptische Urvolk der Kopten hat 1.400 Jahre unter der Herrschaft des Islam – offenbar geistig unbeschadet – überstanden. Heute ist die Zahl der Kopten größer als je zuvor. Wie groß genau, verheimlicht die ägyptische Regierung allerdings. Die koptische Kirche, deren Zeitrechnung mit der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Diokletian beginnt (sie schreiben heute das Jahr 1800), verstand sich von Anfang an als Kirche der Märtyrer. Die römische Kirche hingegen ermöglichte ihren Mitgliedern nach der konstantinischen Wende weltlichen Erfolg. Gestützt auf das römische Recht, bekämpfte sie Häresien wie Manichäismus oder Millenarismus und nicht zuletzt den Islam zum Teil auch militärisch und war dabei zeitweise erfolgreich. Heute droht dem Christentum in Westeuropa trotzdem das Ende. Die Kopten hingegen haben die islamische Eroberung Ägyptens widerstandslos ertragen und dennoch ihren Glauben bewahrt. Das wirft die Frage nach dem Sinn unseres Geschichtsbildes auf: „Unser historisches Bewusstsein ist stark von den Rupturen und Traditionsbrüchen geprägt, welche die Epochen der europäischen Geschichte scharf voneinander abheben“, stellt Mosebach fest. „Darüber ist unser Sinn für die Kontinuitäten der Geschichte geschwächt worden, das Gefühl dafür, dass die Vergangenheit die Geschichte unserer Herkunft ist und in uns, bewusst oder unbewusst, fortdauert. (…) Nach Jesu Himmelfahrt lebte die Welt in einem ständigen Jetzt.“ 

 Erst im Zeitalter der Digitalisierung verstehen wir so richtig, was Trojaner anrichten können. Der christliche Philosoph Dietrich von Hildebrand hat 1968, d.h. nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in seinem Buch „Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes“ vor dem Eindringen des relativistischen postmodernen Zeitgeistes in die christliche Theologie gewarnt. Der in Basel lehrende deutsche Philosoph Harald Seubert möchte in seinem in der Resch-Reihe „Denkanstöße“ erschienen Büchlein die Arbeit Hildebrands fortsetzen. Das wichtigste Einfallstor für Trojaner sei die menschliche Neigung, wie Gott sein und das Himmelreich schon auf Erden errichten zu wollen, betont Seubert. Doch dieser Wunsch führe immer ins Gegenteil, das heißt zur Abschaffung des Menschen als gottebenbildliche Person. Seit der Leugnung der Existenz des Bösen mit einem eigenen Antrieb in der französischen Aufklärung werde die menschliche Schuld immer weniger in der Entfernung des Menschen von Gott, sondern in der Tendenz nur noch im Verhältnis zu sich selbst gesehen. Der Mensch mache sich dadurch an Gottes Stelle zum Richter über andere. Das führe zu einer gnadenlosen „Tribunalisierung der Wirklichkeit“. Indem der Zeitgeist die Existenz der Hölle leugne, bereite er in Wirklichkeit der Hölle auf Erden den Weg. Wer nicht (wie Margot Käsmann von der EKD) an die leibhaftige Auferstehung Jesu glaube oder die in der Bibel geschilderten Wunder relativiere, verabschiede sich vom Christentum, weil er damit Gottes Wirken in der Welt bestreitet. In diesem Zusammenhang erinnert Seubert auch daran, dass das weltferne Gottesbild des Islam für Platon und Aristoteles in die Kategorie des Atheismus fallen würde. Das erklärt meines Erachtens auch die Sympathie, die das postmodere Denken dem Islam entgegenbringt. Wer die Religion zu einer reinen Morallehre machen wolle, unterschlage die biblische Grundeinsicht, dass der Mensch von sich aus nicht fähig ist, das Gute zu bewirken, unterstreicht Harald Seubert. Edgar L. Gärtner
Erst im Zeitalter der Digitalisierung verstehen wir so richtig, was Trojaner anrichten können. Der christliche Philosoph Dietrich von Hildebrand hat 1968, d.h. nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in seinem Buch „Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes“ vor dem Eindringen des relativistischen postmodernen Zeitgeistes in die christliche Theologie gewarnt. Der in Basel lehrende deutsche Philosoph Harald Seubert möchte in seinem in der Resch-Reihe „Denkanstöße“ erschienen Büchlein die Arbeit Hildebrands fortsetzen. Das wichtigste Einfallstor für Trojaner sei die menschliche Neigung, wie Gott sein und das Himmelreich schon auf Erden errichten zu wollen, betont Seubert. Doch dieser Wunsch führe immer ins Gegenteil, das heißt zur Abschaffung des Menschen als gottebenbildliche Person. Seit der Leugnung der Existenz des Bösen mit einem eigenen Antrieb in der französischen Aufklärung werde die menschliche Schuld immer weniger in der Entfernung des Menschen von Gott, sondern in der Tendenz nur noch im Verhältnis zu sich selbst gesehen. Der Mensch mache sich dadurch an Gottes Stelle zum Richter über andere. Das führe zu einer gnadenlosen „Tribunalisierung der Wirklichkeit“. Indem der Zeitgeist die Existenz der Hölle leugne, bereite er in Wirklichkeit der Hölle auf Erden den Weg. Wer nicht (wie Margot Käsmann von der EKD) an die leibhaftige Auferstehung Jesu glaube oder die in der Bibel geschilderten Wunder relativiere, verabschiede sich vom Christentum, weil er damit Gottes Wirken in der Welt bestreitet. In diesem Zusammenhang erinnert Seubert auch daran, dass das weltferne Gottesbild des Islam für Platon und Aristoteles in die Kategorie des Atheismus fallen würde. Das erklärt meines Erachtens auch die Sympathie, die das postmodere Denken dem Islam entgegenbringt. Wer die Religion zu einer reinen Morallehre machen wolle, unterschlage die biblische Grundeinsicht, dass der Mensch von sich aus nicht fähig ist, das Gute zu bewirken, unterstreicht Harald Seubert. Edgar L. Gärtner