Wir wissen es nicht genau, aber klima-wissenschaftliche Vorgaben sind es sicher nicht.
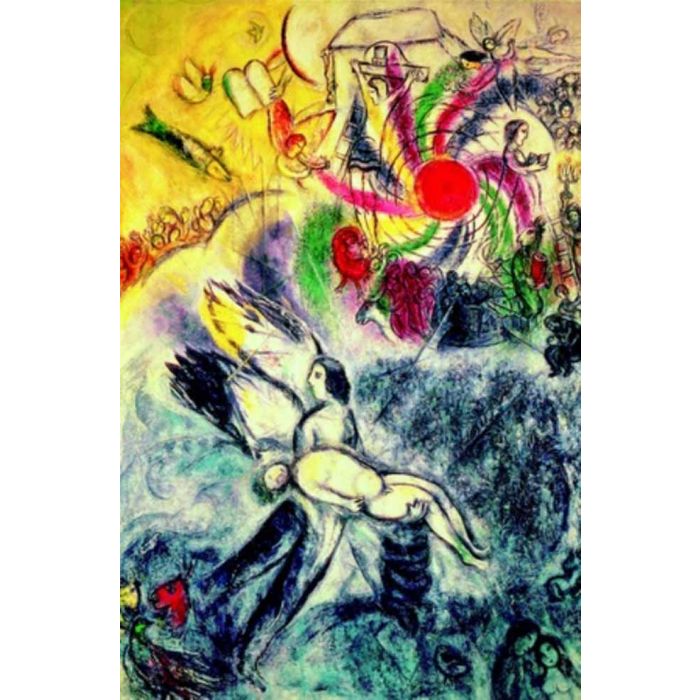
Marc Chagall: Die Erschaffung des Menschen
Edgar L. Gärtner
„Wir brauchen keine 2000 Jahre alten Texte mehr zu lesen, weil wir direkt wissen, was der Planet braucht.“ Diesen Satz legt der Unternehmer und Autor Thomas Eisinger in seinem Roman-Erstling „Hinter der Zukunft“ der Klima-Vizekanzlerin Milena Grosse-Strümpel in den Mund. Es handelt sich dabei durchaus nicht um eine böswillige Unterstellung. Vielmehr entspricht diese Aussage ziemlich genau dem Geist des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 24. März 2021. Darin hat das BVerfG der Klage einiger prominenter Einzelpersonen wie des Schauspielers Hannes Jaenicke und der Fridays-for-Future Aktivistin Luisa Neubauer sowie von grünen Lobby-Vereinen wie Germanwatch, Deutsche Umwelthilfe (DUH), des Solarenergie-Fördervereins Deutschland (SFV), Greenpeace und BUND stattgegeben und das noch junge deutsche Klimaschutz-Gesetz von Ende 2019 für verfassungswidrig erklärt. Deshalb musste der Bundestag die ohnehin schon unrealistisch strengen CO2-Reduktionsziele dieses Gesetzes im Juni 2021 noch weiter ins Utopische verschieben.
Ausgehend von der höchst wackeligen Hypothese eines linearen Zusammenhangs zwischen dem Kohlensäuregehalt und der Durchschnittstemperatur der Erdatmosphäre haben sich die Staaten der Erde im Pariser Klima-Abkommen von 2015 formell darauf geeinigt, den Anstieg der Durchschnittstemperatur seit dem Stichjahr 1990 durch eine Drosselung der anthropogenen CO2-Emissionen auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Der deutsche Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) geht davon aus, dass dem 1,5-Grad-Ziel ein Gesamtbudget von 800 Gigatonnen CO2 entspricht. Entsprechend seiner Einwohnerzahl dürfe Deutschland davon nur noch 6,7 Gigatonnen nutzen. Zu recht fragen Fritz Vahrenholt und Sebastian Lüning in ihrem unter dem Titel „Unanfechtbar?“ veröffentlichten Faktencheck zum BVerfG-Urteil, warum das globale CO2-Budget (vorausgesetzt, dieses erwiese sich als sinnvoll) nicht stattdessen auf Deutschlands Anteil am Welt-Bruttosozialprodukt heruntergebrochen wurde. Dann stünden Deutschland immerhin 32 Gigatonnen CO2 zu. Am 7. Oktober 2021 stellte die Deutsche Energie-Agentur (dena) die von ihr in Auftrag gegebene Studie „Aufbruch Klimaneutralität“ vor. Daraus wird ersichtlich, wie utopisch die sektorbezogenen CO2-Reduktionsziele des neuen Klimaschutzgesetzes sind. Nach Berechnungen der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wird die Umsetzung dieses Gesetzes bis 2045 nicht weniger als fünf Billionen Euro verschlingen.
Es ist aber durchaus nicht allein die Höhe der Kosten, die das verschärfte Klima-Gesetz utopisch macht. Es sind auch nicht allein die inneren Widersprüche und Inkohärenzen grüner Wirtschaftsumbau-Programme, die uns in eine Sackgasse führen. Vielmehr ist es der Versuch, die Klima-Wissenschaft und die daraus abgeleitete Klima-Politik, was immer auch darunter zu verstehen sein mag, zur Klammer für auseinanderbrechende, weil von ihren religiösen bzw. kulturellen Wurzeln abgeschnittene Gesellschaften zu machen. Deutschland mit seinem Klimaschutzgesetz und die EU mit ihrem Wirtschaftslenkungsprogramm namens „Green Deal“ knüpfen damit an der Tradition des „wissenschaftlichen Sozialismus“ bzw. der pseudowissenschaftlichen Rassenlehre an. (Svante Arrhenius, der Erfinder des „Treibhauseffekts“, saß übrigens im Vorstand der schwedischen Gesellschaft für Rassenhygiene.) Selbst wenn sich die CO2-Globaltemperatur-Hypothese verifizieren ließe, sollte sie m.E. nicht zur Vorgabe für die Politik werden, weil sich zeigen lässt, dass ihre praktische Umsetzung statt zur Einigung zu einer Vertiefung der gesellschaftlichen Spaltung führen muss. Weiterlesen





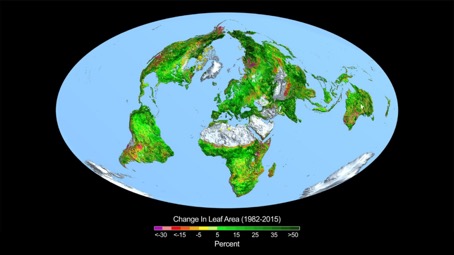


 Bei Sozialisten und Grünen war es schon immer schwer, zwischen Selbsttäuschung und bewusster Lüge zu unterscheiden. So ist es auch bei dem schon lange vor der Kernreaktor-Havarie von Tschernobyl im Jahre 1986 von jungen Wissenschaftlern im Umkreis des Freiburger Öko-Instituts geprägten Begriff „Energiewende“. Bereits im Jahre 1980 legten Autoren des Instituts eine Studie mit dem verheißungsvollen Titel „Energiewende – Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“ vor. Kohlekraftwerke schienen damals noch kein Problem zu sein. Es ging um die Verminderung unserer Abhängigkeit vom Öl des Nahen Ostens und von der damals von linken Grünen schon verteufelten Kernenergie. Im Jahre 1985 veröffentlichten Peter Hennicke, Jeffrey P. Johnson, Stephan Kohler und Dieter Seifried im Frankfurter S. Fischer Verlag eine dicke Studie mit dem Titel „Die Energiewende ist möglich. Für eine neue Energiepolitik der Kommunen“. Wie der Titel andeutet, ging es darin um die Brechung der Macht der großen Stromkonzerne durch die Rekommunalisierung und Dezentralisierung der Elektrizitätsversorgung. Mit der Reaktorkatastrophe von Fukushima hat die Forderung einer radikalen „Energiewende“, historisch betrachtet, nichts zu tun. Dafür schon eher mit dem Wiedererstarken romantischer Strömungen nach der Studentenrevolte von 1968.
Bei Sozialisten und Grünen war es schon immer schwer, zwischen Selbsttäuschung und bewusster Lüge zu unterscheiden. So ist es auch bei dem schon lange vor der Kernreaktor-Havarie von Tschernobyl im Jahre 1986 von jungen Wissenschaftlern im Umkreis des Freiburger Öko-Instituts geprägten Begriff „Energiewende“. Bereits im Jahre 1980 legten Autoren des Instituts eine Studie mit dem verheißungsvollen Titel „Energiewende – Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“ vor. Kohlekraftwerke schienen damals noch kein Problem zu sein. Es ging um die Verminderung unserer Abhängigkeit vom Öl des Nahen Ostens und von der damals von linken Grünen schon verteufelten Kernenergie. Im Jahre 1985 veröffentlichten Peter Hennicke, Jeffrey P. Johnson, Stephan Kohler und Dieter Seifried im Frankfurter S. Fischer Verlag eine dicke Studie mit dem Titel „Die Energiewende ist möglich. Für eine neue Energiepolitik der Kommunen“. Wie der Titel andeutet, ging es darin um die Brechung der Macht der großen Stromkonzerne durch die Rekommunalisierung und Dezentralisierung der Elektrizitätsversorgung. Mit der Reaktorkatastrophe von Fukushima hat die Forderung einer radikalen „Energiewende“, historisch betrachtet, nichts zu tun. Dafür schon eher mit dem Wiedererstarken romantischer Strömungen nach der Studentenrevolte von 1968. Wer sich im heutigen Deutschland noch am Humboldt’schen Bildungsideal orientiert, gilt als verschroben und altmodisch. Vorbei die Zeiten, als das humanistisch inspirierte Ideal der Erziehung junger Menschen zu mündigen, das heißt mit eigener Urteilskraft und Verantwortung ausgestatteter Persönlichkeiten in der halben Welt Nachahmer fand. Bislang lebte dieser Anspruch, wenn auch zusehends verblassend, wenigstens noch ein wenig im Abitur, dem Zertifikat der Hochschulreife am Ende der Gymnasialzeit, weiter. Doch gerade dem Abitur gehen schwarz-rot-grüne Gleichheitsfanatiker in Regierungsämtern nun massiv an den Kragen.
Wer sich im heutigen Deutschland noch am Humboldt’schen Bildungsideal orientiert, gilt als verschroben und altmodisch. Vorbei die Zeiten, als das humanistisch inspirierte Ideal der Erziehung junger Menschen zu mündigen, das heißt mit eigener Urteilskraft und Verantwortung ausgestatteter Persönlichkeiten in der halben Welt Nachahmer fand. Bislang lebte dieser Anspruch, wenn auch zusehends verblassend, wenigstens noch ein wenig im Abitur, dem Zertifikat der Hochschulreife am Ende der Gymnasialzeit, weiter. Doch gerade dem Abitur gehen schwarz-rot-grüne Gleichheitsfanatiker in Regierungsämtern nun massiv an den Kragen.