Edgar L. Gärtner

Bildquelle: shutterstock
Ende November 2018 ging ein Aufschrei um die Welt, als bekannt wurde, dass das Team des chinesischen Genforschers He Jiankui an der Universität Shenzhen erfolgreich in die Keimzellen der Zwillings-Mädchen Lulu und Nana eingegriffen hat, um eine Anlage für HIV/AIDS auszuschalten. Zwar gibt es schon seit Beginn der 1990er Jahre mehr oder weniger erfolgreiche Versuche einer gezielten Reparatur krankhaft veränderter Gene. Doch immer handelte es sich dabei um Eingriffe in Körperzellen. Eingriffe in die Keimzellen gelten bis heute als Tabu, weil nach dem heutigen Stand des Wissens niemand ausschließen kann, dass sich dadurch auch unerwünschte genetische Veränderungen unkontrolliert und nicht rückrufbar in der Nachkommenschaft ausbreiten könnten. Deshalb verurteilte auch die große Mehrheit der chinesischen Genforscher He Jiankuis Schritt formell. Dieser bediente sich bei seinem Eingriff einer neuen, erst seit 2012 bekannten Technik mit dem zungenbrecherischen Namen CRISPR/Cas9, die von der französischen Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier und der amerikanischen Biochemikerin Jennifer Doudna entwickelt wurde. Weiterlesen



 Das vorliegende Buch, das sich spannender als ein Vatikan-Reißer von Dan Brown liest, erschien zunächst lediglich online in englischer Sprache. Die von einem Vatikan-Insider unter Pseudonym veröffentlichte Abhandlung enthüllt Hintergründe und Interna des Rücktritts des hochgelehrten deutschen Papstes Benedikt XVI. sowie der Wahl und des Regierungsstils seines hemdsärmeligen argentinischen Nachfolgers Franziskus (Jorge Mario Bergoglio). Inzwischen wurde der Autor enttarnt. Es handelt sich um den britischen Historiker Henry Sire, der als Mitglied des Malteser-Ordens längere Zeit im Vatikan weilte. Der Malteser-Orden suspendierte ihn daraufhin. Seine Recherchen führten Sire zum Schluss, dass es sich bei Bergoglio um eine der gefährlichsten Gestalten handelt, die je den Stuhl Petri bestiegen hat. Bei seiner Wahl habe nicht der Heilige Geist, sondern ein geheimes Netzwerk linksliberaler Kardinäle die Fäden gezogen. Dessen Spiritus rector, der belgische Kardinal Godfried Daneels, bezeichnete dieses Netzwerk nach der geglückten Wahl Bergoglios selbst in einem TV-Interview als „St.Gallen-Mafia“.
Das vorliegende Buch, das sich spannender als ein Vatikan-Reißer von Dan Brown liest, erschien zunächst lediglich online in englischer Sprache. Die von einem Vatikan-Insider unter Pseudonym veröffentlichte Abhandlung enthüllt Hintergründe und Interna des Rücktritts des hochgelehrten deutschen Papstes Benedikt XVI. sowie der Wahl und des Regierungsstils seines hemdsärmeligen argentinischen Nachfolgers Franziskus (Jorge Mario Bergoglio). Inzwischen wurde der Autor enttarnt. Es handelt sich um den britischen Historiker Henry Sire, der als Mitglied des Malteser-Ordens längere Zeit im Vatikan weilte. Der Malteser-Orden suspendierte ihn daraufhin. Seine Recherchen führten Sire zum Schluss, dass es sich bei Bergoglio um eine der gefährlichsten Gestalten handelt, die je den Stuhl Petri bestiegen hat. Bei seiner Wahl habe nicht der Heilige Geist, sondern ein geheimes Netzwerk linksliberaler Kardinäle die Fäden gezogen. Dessen Spiritus rector, der belgische Kardinal Godfried Daneels, bezeichnete dieses Netzwerk nach der geglückten Wahl Bergoglios selbst in einem TV-Interview als „St.Gallen-Mafia“. 


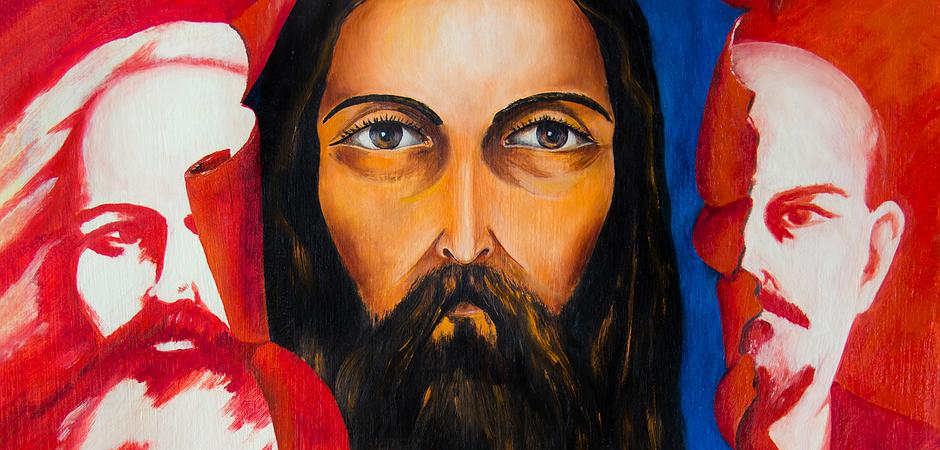
 Der Katholik Martin Mosebach, bekannt als Autor erfolgreicher Romane wie auch als scharfer Kritiker der Liturgie-Reform seiner Kirche nach dem II. Vatikanum, sieht im Bluts-Zeugnis der im Februar 2015 am libyschen Strand von vermummten IS-Terrorsten hingerichteten 21 christlichen Wanderarbeiter einen Anlass, um der Frage nachzugehen, wie die römische Kirche die Unterwerfung unter die relativistische Zivilreligion beziehungsweise die Islamisierung noch verhindern könnte. Das ägyptische Urvolk der Kopten hat 1.400 Jahre unter der Herrschaft des Islam – offenbar geistig unbeschadet – überstanden. Heute ist die Zahl der Kopten größer als je zuvor. Wie groß genau, verheimlicht die ägyptische Regierung allerdings. Die koptische Kirche, deren Zeitrechnung mit der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Diokletian beginnt (sie schreiben heute das Jahr 1800), verstand sich von Anfang an als Kirche der Märtyrer. Die römische Kirche hingegen ermöglichte ihren Mitgliedern nach der konstantinischen Wende weltlichen Erfolg. Gestützt auf das römische Recht, bekämpfte sie Häresien wie Manichäismus oder Millenarismus und nicht zuletzt den Islam zum Teil auch militärisch und war dabei zeitweise erfolgreich. Heute droht dem Christentum in Westeuropa trotzdem das Ende. Die Kopten hingegen haben die islamische Eroberung Ägyptens widerstandslos ertragen und dennoch ihren Glauben bewahrt. Das wirft die Frage nach dem Sinn unseres Geschichtsbildes auf: „Unser historisches Bewusstsein ist stark von den Rupturen und Traditionsbrüchen geprägt, welche die Epochen der europäischen Geschichte scharf voneinander abheben“, stellt Mosebach fest. „Darüber ist unser Sinn für die Kontinuitäten der Geschichte geschwächt worden, das Gefühl dafür, dass die Vergangenheit die Geschichte unserer Herkunft ist und in uns, bewusst oder unbewusst, fortdauert. (…) Nach Jesu Himmelfahrt lebte die Welt in einem ständigen Jetzt.“
Der Katholik Martin Mosebach, bekannt als Autor erfolgreicher Romane wie auch als scharfer Kritiker der Liturgie-Reform seiner Kirche nach dem II. Vatikanum, sieht im Bluts-Zeugnis der im Februar 2015 am libyschen Strand von vermummten IS-Terrorsten hingerichteten 21 christlichen Wanderarbeiter einen Anlass, um der Frage nachzugehen, wie die römische Kirche die Unterwerfung unter die relativistische Zivilreligion beziehungsweise die Islamisierung noch verhindern könnte. Das ägyptische Urvolk der Kopten hat 1.400 Jahre unter der Herrschaft des Islam – offenbar geistig unbeschadet – überstanden. Heute ist die Zahl der Kopten größer als je zuvor. Wie groß genau, verheimlicht die ägyptische Regierung allerdings. Die koptische Kirche, deren Zeitrechnung mit der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Diokletian beginnt (sie schreiben heute das Jahr 1800), verstand sich von Anfang an als Kirche der Märtyrer. Die römische Kirche hingegen ermöglichte ihren Mitgliedern nach der konstantinischen Wende weltlichen Erfolg. Gestützt auf das römische Recht, bekämpfte sie Häresien wie Manichäismus oder Millenarismus und nicht zuletzt den Islam zum Teil auch militärisch und war dabei zeitweise erfolgreich. Heute droht dem Christentum in Westeuropa trotzdem das Ende. Die Kopten hingegen haben die islamische Eroberung Ägyptens widerstandslos ertragen und dennoch ihren Glauben bewahrt. Das wirft die Frage nach dem Sinn unseres Geschichtsbildes auf: „Unser historisches Bewusstsein ist stark von den Rupturen und Traditionsbrüchen geprägt, welche die Epochen der europäischen Geschichte scharf voneinander abheben“, stellt Mosebach fest. „Darüber ist unser Sinn für die Kontinuitäten der Geschichte geschwächt worden, das Gefühl dafür, dass die Vergangenheit die Geschichte unserer Herkunft ist und in uns, bewusst oder unbewusst, fortdauert. (…) Nach Jesu Himmelfahrt lebte die Welt in einem ständigen Jetzt.“ 